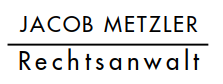Das Markengesetz (MarkenG) schützt zunächst Marken und sonstige Kennzeichen, wie geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben.
Marken sind besondere, rechtlich geschützte Zeichen, die vor allem dazu dienen, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Marken dienen dazu, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (Herkunftsfunktion). Neben diese „Hauptfunktion“ treten weitere Funktionen, wie z.B. die Werbefunktion, die Kommunikationsfunktion und die Garantiefunktion, d. h. die Verantwortlichkeit des Markeninhabers für die Qualität der Ware.
Der Begriff der „Marke“ umfasst Registermarken, Benutzungsmarken, Notorietätsmarken und Kollektivmarken.
- Registermarken entstehen durch die Eintragung eines Zeichens im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes.
- Benutzungsmarken entstehen durch die Ingebrauchnahme eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, wenn die Benutzung zu Verkehrsgeltung geführt hat. Unter dem Begriff der „Verkehrsgeltung“ wird die durch bloße Benutzung entstandene Funktion als Herkunftshinweis verstanden. Weil der Verwender ein nicht eingetragenes Zeichen in der gleichen Art wie eine eingetragene Marke benutzt hat, lässt sich daraus schließen, dass dieses Zeichen einen Herkunftshinweis darstellt.
- Notorietätsmarken entstehen beim Vorliegen der notorischen Bekanntheit im Inland.
Sonstige Kennzeichen sind geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel) und geographische Herkunftsangaben.
Markenschutz entsteht
- durch die Eintragung eines Zeichens in das Register des Patentamtes,
- durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr oder
- durch die notorische Bekanntheit einer Marke.
- Eine Wortmarke besteht ausschließlich aus Zeichen, die sich in Druckschrift darstellen lassen. Die Liste der Zeichen umfasst die üblichen Buchstaben in Klein- und Großschreibung, Zahlen und einige Sonderzeichen. Eine Marke, die andere Zeichen enthält, kann nicht als Wort-, sondern nur als Wort-/ Bildmarke geschützt werden. Der Schutz einer Wortmarke umfasst alle üblichen Darstellungsformen der Buchstaben- bzw. Zeichenfolge. So kann die Wortmarke immer wieder durch Neugestaltung des Schriftzuges angepasst werden.
- Wort-/ Bildmarken bestehen aus einer Kombination von Zeichen und Grafik, d.h. in Form von Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Zeichen und Bildelement, grafischer Gestaltung oder einer speziellen Anordnung.
- Bildmarken bestehen ausschließlich aus Bildern, Bildelementen oder Abbildungen ohne Buchstaben oder sonstige Zeichen. Sie kommen als Etiketten, Siegel, Hologramme und Abbildungen von Menschen oder Gegenständen vor.
- Dreidimensionale Marken werden in Warenformmarken (Michelin-Männchen) und Verpackungsformmarken (z.B. Granini-Flasche) unterteilt. Warenformmarken werden immer häufiger, weil viele Anmelder durch sie die ästhetischen Elemente ihres Produktdesigns gegen Konkurrenten absichern wollen. das richtige Schutzrecht für Designs ist jedoch das Geschmacksmuster.
- Hörmarken sind vom Gehör wahrnehmbare Zeichen wie Töne, Tonfolgen, Melodien oder sonstige Klänge und Geräusche wie Hupen, Zerbrechen von Glas, Donner sowie Klangbilder. Problematisch ist meist die mangelnde grafische Darstellbarkeit von Geräuschen für das Register.
- Zu den sonstigen Markenformen zählen Geruchsmarken, Positionsmarken (z.B. Knopf im Ohr der Firma Steiff, Ziernähte an Jeans), abstrakte Farbmarken (z.B. Milka-Lila), Kennfadenmarke, Tastmarken, Bewegungsmarken (z.B. Tatort-Vorspann).
Markenanmelder bzw. –inhaber kann jede rechtsfähige Person sein. Dazu zählen natürliche Personen (Menschen), juristische Personen (z.B. GmbH) und Personengesellschaften. Sind mehrere natürliche Personen an der Entwicklung der Marke beteiligt, brauchen sie für das Anmeldeverfahren einen gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten, auf den sie sich als Kontaktperson einigen. Während des gesamten Verfahrens sind jedoch sämtliche Unterschriften der Mitanmelder erforderlich.
Von der Eintragung sind Marken ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, bei einem Freihaltebedürfnis am Markenzeichen und Zeichen, die lediglich eine übliche Bezeichnung darstellen.
- Fehlende Unterscheidungskraft wird angenommen, wenn man der Marke nur eine im Vordergrund stehende beschreibende Aussage oder eine Sachinformation für das Produkt entnimmt (z.B. „Ökofisch“, „Birnensaft“). Des Weiteren fehlt die Unterscheidungskraft bei Angaben, die so gebräuchlich im Deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache sind, dass man sie nur als solche, nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffasst.
- Das als Freihaltebedürfnis bezeichnete Schutzhindernis erfasst Markenzeichen, die Eigenschaften des konkreten Produkts beschreiben können (z.B. „Deutsche Gesellschaft für Religionsfreiheit“ für die Förderung und Wahrung der Grundsätze der Religionsfreiheit).
- Übliche Bezeichnungen sind allgemein gebräuchliche, verkehrsübliche Bezeichnungen für die Produkte, die man nur noch als Hinweis auf das Produkt, nicht mehr auf den Anbieter versteht.
Grundlage zur Erlangung des Markenschutzes durch eine Registermarke ist ein Antrag, der beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einzureichen ist. Dieser Antrag muss Angaben über die Identität des Anmelders enthalten, die Wiedergabe der Marke und eine Angabe zu den Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird. Mit Eingang des Antrags beim DPMA steht der Anmeldetag fest. Der Anmeldetag bestimmt den Zeitrang der Anmeldung. Im Anschluss wird geprüft, ob das Zeichen zur Eintragung geeignet ist. Führt diese Prüfung zu keinen Beanstandungen, wird die Marke in das Markenregister eingetragen. Die bloße Eintragung einer Marke garantiert ihrem Inhaber nicht, dass und inwieweit sie gegenüber älteren Registermarken Bestand haben wird. Es ist vorerst eine dreimonatige Widerspruchsfrist abzuwarten. Auch nach Ablauf der Frist und ohne Eingang eines Widerspruchs können jederzeit Verfahren wegen einer möglichen Kollision vor Gericht geführt werden.
Marken, die beim DPMA im Register eingetragen sind, genießen nur in Deutschland einen Schutz. Für den Schutz in der EU ist ein Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt erforderlich. Eine internationale Registrierung kann bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) beantragt werden. Je größer der Schutzbereich gewählt wird, desto höher sind die Anmeldegebühren.
Eine Marke dient der Unterscheidung für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen. Deshalb muss der Anmelder bei Anmeldung der Marke bestimmte Branchen festlegen, für welche die Marke gelten soll. Dies geschieht über die Erstellung eines Verzeichnisses für Waren- und Dienstleistungen. Alle denkbaren Produkte sind nach bestimmten Kriterien in Klassen eingeteilt. Es gibt 45 verschiedene Klassen. Die Klasseneinteilung bestimmt sich nach der europäischen Klassifikationsrichtlinie zur Rechtsvereinheitlichung. Die Klassen sind so gewählt, dass theoretisch jedes denkbare Produkt erfasst wird.
Maßgeblich für das Verzeichnis ist die Festlegung eines Tätigkeitsfeldes bzw. einer Branche, die durch die Marke gekennzeichnet werden soll. In den Anmeldegebühren ist die Festlegung von bis zu drei Klassen enthalten. Soll das Tätigkeitsfeld in Zukunft erweitert werden, sollte dies bereits bei der Anmeldung berücksichtigt werden. Das Verzeichnis kann während des Verfahrens nicht erweitert, sondern nur eingeschränkt werden. Im Anschluss an die Festlegung der Branche muss der Anmelder die entsprechenden Klassen benennen, die für das Tätigkeitsfeld inhaltlich am besten passen. Anhand der exemplarischen Oberbegriffe der Klassen kann sich der Anmelder grob orientieren, welche Tätigkeit die entsprechende Klasse abdeckt. Es kann ebenso in der umfassenden alphabetisch sortierten Liste der Waren und Dienstleistungen nach dem Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation nach passenden Begriffen gesucht werden. Die ausgewählten Klassen sind nach den Nummern aufsteigend im Anmeldeformular anzugeben. Im Anschluss hat der Anmelder die Möglichkeit eine Leitklasse vorzuschlagen. Diese stellt dann den prognostizierten Schwerpunkt der wirtschaftlichen Betätigung dar. Die Leitklasse bestimmt die Zuständigkeit der Markenabteilung und bestimmt, unter welcher Klasse die Marke bei Eintragung veröffentlicht wird.
Sie sollten immer vorab prüfen, ob eine Marke noch verfügbar ist. Meist erweist sich eine umfangreiche Markenrecherche als sinnvoll, um sich vor Ansprüchen Dritter zu schützen. Auf unserer Webseite können Sie sich vergewissern, ob Ihre Wunschmarke oder ein ähnliches Zeichen bereits im Register eingetragen ist.
Wie generell im Wettbewerbsrecht gilt auch für Marken das Prioritätsprinzip, so dass grundsätzlich der, der die Marke zuerst „hatte“ und dies durch Registereintrag oder Benutzung nachweisen kann, daran in seiner und verwandten Branchen immer Vorrechte gegenüber allen hat, die diese später identisch oder ähnlich beanspruchen oder verwenden. Die Markenanmeldung bedarf daher einer sorgfältigen Vorbereitung, damit es nicht zu Widersprüchen von Markeninhabern bereits bestehender Marken kommt. Störungen oder Verzögerungen können den Erfolg einer neuen Marke entscheidend beeinflussen und darüber hinaus im Falle von Verletzungen bestehender Markenrechte zu teuren Rechtsstreitigkeiten führen. Vor der Anmeldung einer Marke ist daher eine Markenrecherche erforderlich.
Die Markenrecherche umfasst eine Identitätsrecherche und eine Ähnlichkeitsrecherche. Die Identitätsrecherche umfasst die Suche nach Marken mit identischen Namen wie der Wunschmarke. Der Schutz einer Marke umfasst jedoch auch solche Namen mit ähnlicher Schreibweise und Aussprache. Damit befasst sich die Ähnlichkeitsrecherche. Dabei wird nach bereits eingetragenen Marken gesucht, bei denen Ausspracheähnlichkeit besteht. Von der Recherche werden zudem Marken erfasst, bei denen Schriftbildähnlichkeit besteht, da sie ähnliche Zeichen bzw. Buchstaben nutzen. Ebenfalls erfasst werden Marken, die nur in einem Teil des Namens ähnlich sind.
Die Eintragung einer Marke erfolgt ohne Berücksichtigung anderer Registermarken. Innerhalb von drei Monaten kann gegen die Eintragung Widerspruch eingelegt werden. Dieser hat Erfolg, wenn eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen zwei eingetragenen Marken besteht. Die Verwechslungsgefahr zweier Marken soll vermieden werden, weil eine solche Verwechslung den Sinn der Marke zunichte macht.
Es wird zwischen unmittelbarer Verwechslungsgefahr und Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung unterschieden.
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die von den Vergleichszeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen (zusammen: Produkte) aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Maßgeblich für das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ist die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen, die Zeichenähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen den relevanten Faktoren. Es kann also ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Produkte durch einen höheren Grad der Zeichenähnlichkeit oder erhöhte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden und umgekehrt. Alle relevanten Umstände werden umfassend beurteilt. Ist einer der Faktoren Null, scheidet eine Verwechslungsgefahr aus. Die Beurteilung und Prognose der Verwechslungsgefahr erfolgt aus dem Blickwinkel des Abnehmers der konkreten Produkte, d.h. aus Sicht eines aufmerksamen, verständigen, durchschnittlich informierten Verbrauchers.
Bei der Ähnlichkeit der Produkte wird die Branchennähe geprüft und ob sich die Produkte an dieselben Verkehrskreise richten. Dabei kommt es auf die tatsächliche Verwendung der Produkte auf dem Markt an.
Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke betrifft den Grad ihrer Eignung, sich dem angesprochenen verständigen Abnehmer der konkreten Produkte durch ihre Eigenart und gegebenenfalls Bekanntheit infolge Benutzung einzuprägen und daher als Herkunftshinweis für die Produkte zu wirken. Dabei kommt einer bekannten Marke ein größerer Schutzumfang zu als einer unbekannten Marke.
Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit kommt es darauf an, ob der Abnehmer das eine Markenzeichen mit dem anderen klanglich, visuell, begrifflich oder sonst in Verbindung bringt. Die Markenähnlichkeit kann von absolut unähnlich bis identisch reichen.
Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung besteht, wenn beide Marken trotz ihrer uneinheitlichen Bezeichnung gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Das Hervorrufen irgendeiner allgemeinen Assoziation oder vagen Verbindung zum anderen Zeichen genügt für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht.
Um von potentiell verwechselbaren Neueintragungen zu erfahren, muss sich der Markeninhaber regelmäßig über die neu eingetragenen Marken informieren, um rechtzeitig innerhalb der dreimonatigen Frist Widerspruch einlegen zu können. Es besteht die Möglichkeit, sich eines professionellen Markenüberwachungsdienstes zu bedienen. Dieser überprüft permanent elektronisch die Veröffentlichungen der Markenämter darauf, ob eine Neueintragung betreffend Markenzeichen und Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der eigenen eingetragenen Marke nahe kommt.
Jede Person hat die Möglichkeit beim DPMA einen Löschungsantrag gegen eine eingetragene Registermarke stellen. Der Antrag ist zulässig, wenn er schriftlich gestellt wird, einen Löschungsgrund enthält und innerhalb von zehn Jahren nach Eintragung erfolgt. Es erfolgt eine erneute Prüfung der Marken- und Schutzfähigkeit.
Im Kollisionsverfahren geht es um die Überprüfung, ob eine neu eingetragene Marke mit einer älteren Registermarke verwechselbar ist.